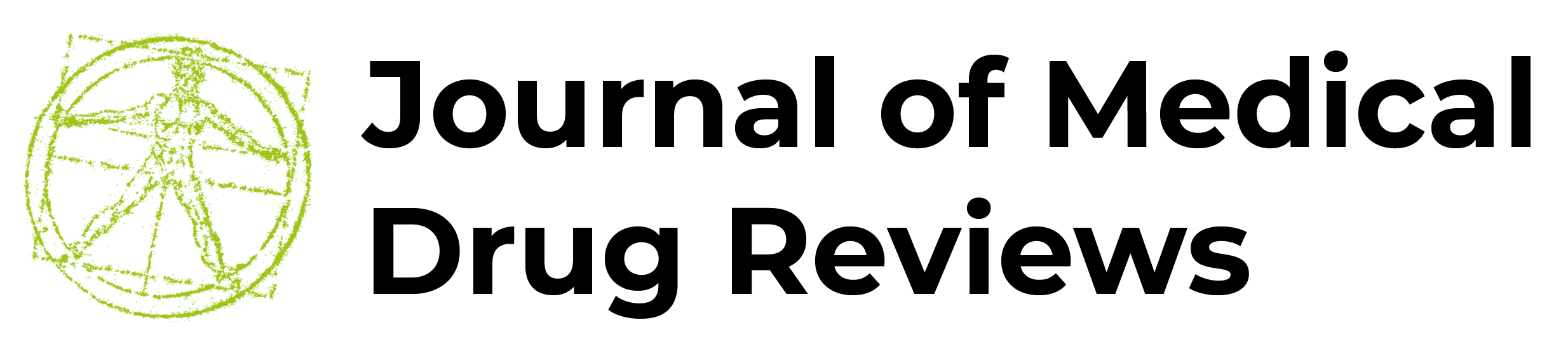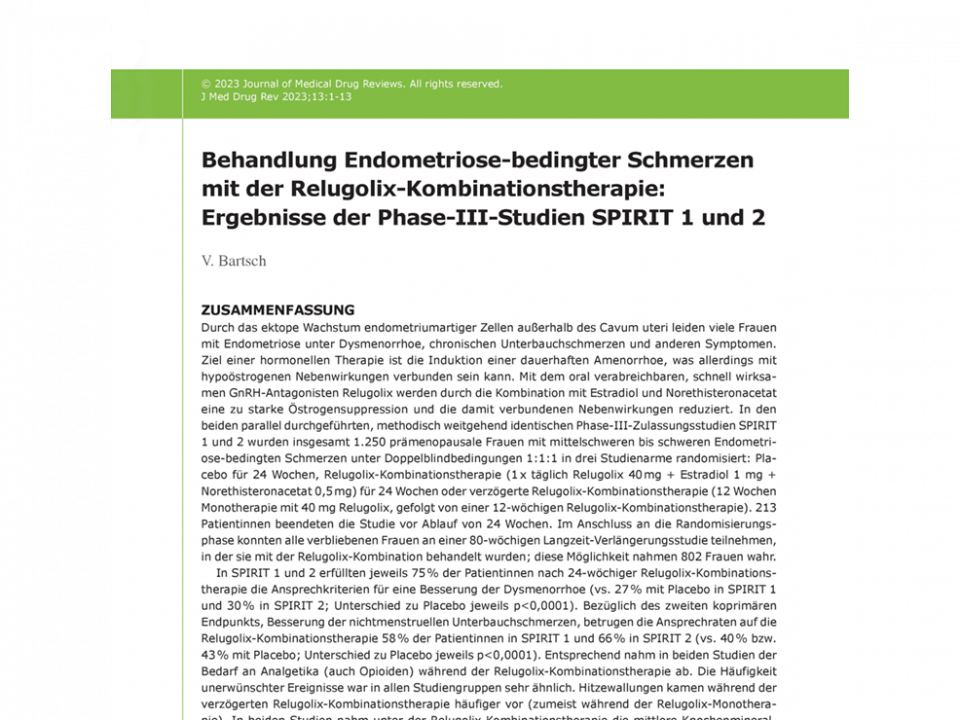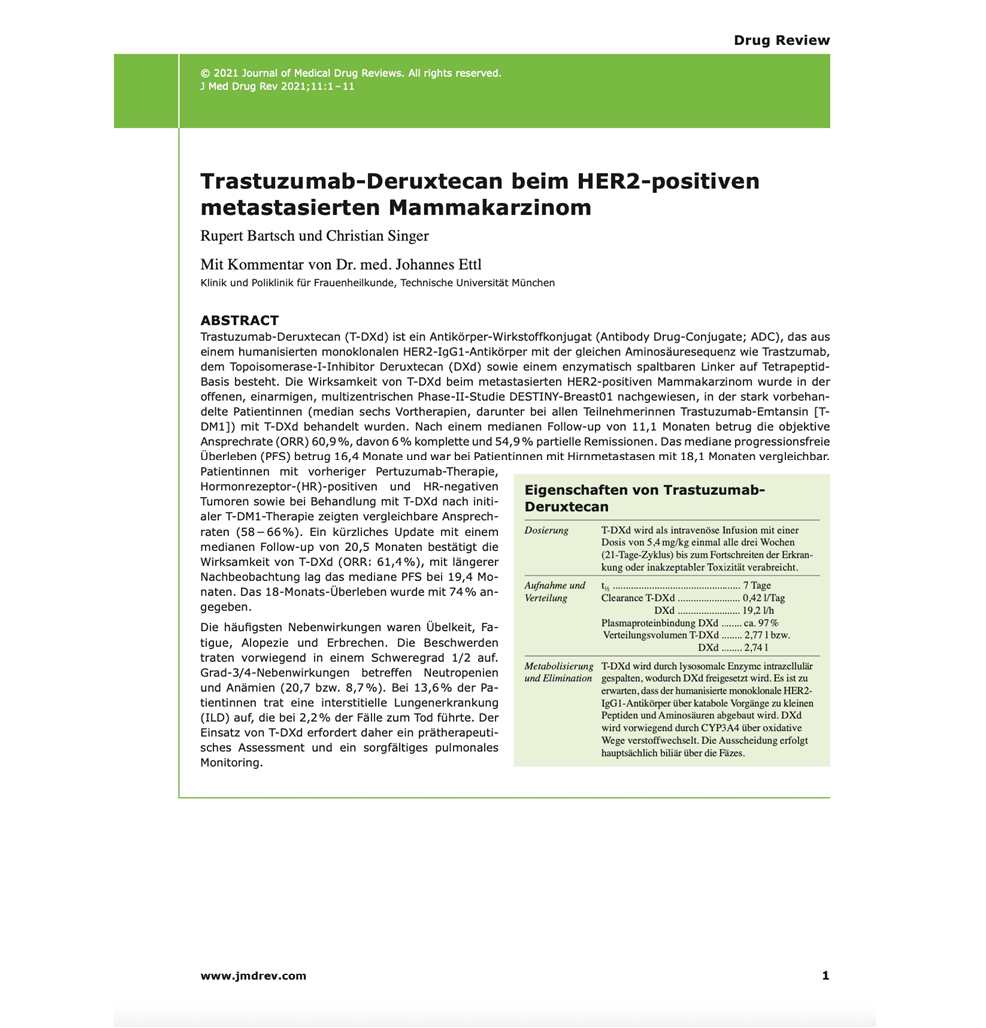Pharmakokinetische Spezifika von zwei Präparaten und deren mögliche Auswirkungen auf den Therapieerfolg
J Med Drug Rev 2022; 12:1–8
English version below
Dem Morbus Wilson liegt ein genetischer Defekt des Kupferstoffwechsels zugrunde, wodurch es zu einer toxischen Akkumulation von Kupfer vor allem in Leber und Gehirn kommt. Im symptomatischen Stadium stehen als Therapeutika die oralen Kupferchelatbildner D-Penicillamin und Trientin zur Verfügung. D-Penicillamin wird von den Leitlinien als erste Option empfohlen. Treten unter dieser Therapie schwere Nebenwirkungen auf, wird auf das besser verträgliche Trientin umgestellt. Bei allen zur Therapie des Morbus Wilson zugelassenen Arzneimitteln wird die enterale Resorptionsrate des Chelatbildners durch Nahrungsaufnahme deutlich reduziert, sodass die Patienten strenge Abstandsregeln zu den Mahlzeiten einhalten müssen. Da Trientin zudem in 2–4 Einzeldosen über den Tag verteilt einzunehmen ist, können daraus für den Patienten organisatorische Herausforderungen und Adhärenzprobleme erwachsen. Zwischen den beiden in der EU zentral zugelassenen Trientin-Präparaten Cuprior® (Trientin-Tetrahydrochlorid) und Cufence® (Trientin-Dihydrochlorid) gibt es allerdings pharmakokinetische Unterschiede, die im Patientenalltag durchaus relevant sein können. Zwar haben beide Trientinsalze den gleichen Wirkmechanismus, doch wird das Tetrahydrochlorid (Trientin 4HCl) aus der Formulierung deutlich schneller freigesetzt und besser resorbiert als das Dihydrochlorid (Trientin 2HCl). Daraus ergibt sich für Trientin 4HCl eine höhere Bioverfügbarkeit, was wiederum die einzunehmende Dosis und damit die Zahl der Tabletten für die Patienten reduziert. Bereits 30 Minuten nach Einnahme von Trientin 4HCl werden 73% des maximalen Plasmaspiegels erreicht, nach Einnahme von Trientin 2HCl lediglich 21%. Dies deutet darauf hin, dass eine unzureichende Einhaltung des 1-stündigen Abstands zu einer nachfolgenden Mahlzeit bei Behandlung mit Trientin 4HCl geringere Auswirkungen auf die Wirkstoffexposition und damit das Ausmaß der Kupferelimination haben könnte. Schlussfolgerung: Wirkstofffreisetzung, Resorption und Einfluss von Nahrung auf die Bioverfügbarkeit sollten berücksichtigt werden, um sich für die vorteilhaftere Trientin-Formulierung entscheiden zu können, denn die Serumkonzentration des aktiven Wirkstoffs bestimmt letztendlich die Wirksamkeit der Therapie.